Aus Haltung gespeist, zum Handeln gedrängt


Der Vortrag des Preisträgers im Video
Externer Inhalt
Dieser Inhalt von
youtube.com
wird aus Datenschutzgründen erst nach expliziter Zustimmung angezeigt.
Er sei nicht weniger als ein Hoffnungsträger, sagte Laudator Stephan Hebel von der Frankfurter Rundschau bei der Verleihung des Walter-Dirks-Preises im Frankfurter Bartholomäusdom über Preisträger Wolfgang Kessler. Auch wenn das Wort – gerade zu Zeiten einer Fußball-Europameisterschaft – häufig über besonders talentierte Kicker zu lesen sei, gehe die Bedeutung in diesem Fall tiefer, so Hebel: „Ich spreche von einem Menschen, der in einem viel umfassenderen Sinn Hoffnung trägt, und zwar sowohl in sich als auch nach außen. Es ist eine Hoffnung, die sich aus Haltung speist und zum Handeln drängt!“






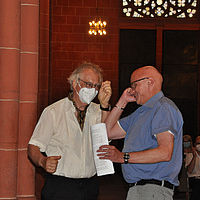

Der Frankfurter Walter-Dirks-Preis ist nach dem bedeutenden Publizisten Walter Dirks (1901-1991) benannt und wird seit 2010 gemeinsam vom Haus am Dom und dem Haus der Volksarbeit verliehen. Ausgezeichnet werden Menschen, die in wachsamer Zeitgenossenschaft und engagiert für soziale Gerechtigkeit wie Dirks unkonventionelle Brücken-Schläge zwischen Konfessionen, Religionen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Parteien gewagt haben.
Zu ihnen gehört nun auch der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Dr. Wolfgang Kessler. Er empfinde es als große Ehre, diesen Preis in der Tradition der Dirkschen Ideale – aufrechter Glaube, freiheitlicher Sozialismus, Versöhnung, europäische Einigung – entgegen nehmen zu dürfen, machte dies aber nicht an seiner Person fest: „Ich empfinde überhaupt die Vergabe eines Walter Dirks Preises als wichtig. Denn kongeniale, aber gleichzeitig kontroverse Persönlichkeiten wie Walter Dirks, die sich einer klaren Vereinnahmung durch Parteien, Verbände oder Kirchen entziehen , drohen immer in Vergessenheit zu geraten“, so Kessler.
Stimme mit sozialem Gewissen
Er erhielt den renommierten Preis in Form eines irdenen Hahnes für seine langjährige Tätigkeit als Chefredakteur bei Publik-Forum, einer alle 14 Tage erscheinenden Zeitschrift mit inhaltlichem Schwerpunkt auf kirchlichen, religiösen und gesellschaftlichen Themen. 1991 kam Kessler als Ressortleiter für Politik und Gesellschaft in die Redaktion und erarbeitete sich einen Ruf als Stimme mit sozialem Gewissen. Seit 1999 war er bis zu seinem Abschied in den Ruhestand 2019 Chefredakteur. Der gebürtige Schwabe, Jahrgang 1953, beschäftigt sich in zahlreichen Büchern und auf Vorträgen mit Wegen zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft auf ethischer Grundlage.
Wegen der Pandemie war die Preisverleihung mehrmals verschoben worden und fand nun, anders als sonst beim Walter-Dirks-Gedenken im Haus am Dom üblich, in reduzierter Form statt: mit einem live gestreamten Vortrag des Preisträgers zum Thema „Die Kunst, den Kapitalismus zu verändern“ am Nachmittag und einer anschließenden feierlichen Preisverleihung im Rahmen eines Abendgebets im Dom.
Schwerer Preis für schwere Themen
Kessler nahm den irdenen Hahn, der einiges an Gewicht auf die Waage bringt, sichtlich gerührt entgegen. Übergeben wurde er vom Juryvorsitzenden Dr. Hejo Manderscheid, Julia Wilke-Henrich, Geschäftsführerin des von Dirks mitbegründeten Hauses der Volksarbeit, sowie Dr. Thomas Wagner, Studienleiter der Katholischen Akademie Rabanus Maurus. Die Wahl sei für ihn schon sehr überraschend gewesen, sagte der Preisträger, der an diesem Abend mit seinem Sohn in den Dom gekommen war: „Ich wandelte zwar immer wieder auf den Spuren von Walter Dirks, aber ich durfte ihn nie persönlich kennenlernen - ich kam immer irgendwie zu spät.“
Stadtrat Bernd Heidenreich gratulierte dem Preisträger im Namen der Stadt Frankfurt. Menschen, die in Gesellschaft, Politik und Kultur Brücken schlagen. „Ich denke, solche Persönlichkeiten brauchen wir heute mehr denn je, in der die kulturellen, sozialen und religiösen Gegensätze größer werden“, sagte Heidenreich. Viele Menschen fühlten sich unverstanden und abgehängt, die Folgen seien dramatisch: Die Mitte schrumpfe, die Extreme auf der rechten und auch linken Seite wachsen. „Auch in Frankfurt spüren wir, wie unser Land an innerem Zusammenhalt verliert: Die Spitzen von Wirtschaft, Kultur und Politik und die Kassiererin aus dem Supermarkt um die Ecke – sie leben längst in unterschiedlichen Welten.“
Kapitalismus, der die Natur unterwirft
Diese soziale Ungerechtigkeit ist eins der Kernthemen von Wolfgang Kessler, der auch seine Dankesrede dafür nutzte, mit deutlichen Worten auf Missstände hinzuweisen: „Dem renditehungrige Kapitalismus sind immer mehr Lebensbereiche unterworfen; nicht zuletzt diese Entwicklung ist dafür verantwortlich, dass die Vermögen in einem Land wie Deutschland immer ungleicher verteilt sind, dass die Spitzeneinkommen inzwischen um ein 50faches höher sind als die Durchschnittseinkommen.“ Artensterben und Klimakrise seien Folgen eines Wachstums-Kapitalismus, der sich die Natur unterwerfe.
Begründung der Jury
Die Jury des Preises, der zum 14. Mal von der Katholischen Akademie und dem Haus der Volksarbeit vergeben wurde, begründete die Preisvergabe mit dem Eintreten von Kessler für einen engagierten Journalismus, der bereit sei, sich auch „mit bestimmten Dingen gemeinzumachen und für sie einzutreten“, wie Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Für diese Bemühungen erhielt er 2007 auch den Bremer Friedenspreis.
Die Haltung der Zeitschrift Publik Forum stehe in ihrem kritisch-christlichen Profil dem Denken von Dirks sehr nahe: „Wolfgang Kessler hat es verstanden, in der Redaktion sehr unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu führen und bei Konflikten zu moderieren, dass das Profil der Zeitschrift zugleich bewahrt und geschärft wurde.“ Das Credo „Parteilichkeit ohne institutionelle Parteinahme“ gelte besonders für Kesslers eigenes Fach, die Volkswirtschaft. Mit jahrzehntelanger Beharrlichkeit habe Kessler an der „Kunst, den Kapitalismus zu verändern“ (so sein jüngster Buchtitel) gearbeitet und stehe damit ganz in der Tradition von Dirks.
Die Rede des Preisträgers sowie die Laudatio auf ihn gibt es hier in ganzer Länge nachzulesen:
Laudatio auf Wolfgang Kessler
von Stephan Hebel
Lieber Wolfgang Kessler, sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin sehr froh, dass wir uns heute persönlich treffen können, um Ihnen, lieber Herr Kessler, diesen hochverdienten Preis zu verleihen. Es hat ja lange genug gedauert, und auf Dauer wäre es auch peinlich geworden, dass Sie schneller Bücher schreiben, als man Ihnen Preise verleihen kann. Das neueste ist gerade erschienen, ich komme noch darauf.
Zunächst bedanke ich mich bei allen Beteiligten, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein paar Worte zu sagen. Ich möchte mich dabei von einem schönen Wort leiten lassen, das Wolfgang Kessler und sein Werk mit dem Erbe von Walter Dirks auf wunderbare Weise verbindet. Hoffnung, das ist das Leitmotiv, das mir bei beiden Autoren in den Sinn kommt.
Ja, lieber Herr Kessler, für mich sind Sie ein Hoffnungs-Träger im wörtlichen Sinne. Das mag ein bisschen seltsam klingen für einen Mann im siebten Lebensjahrzehnt, und ich bin tatsächlich etwas unsicher geworden, als ich in Vorbereitung auf den heutigen Abend die Schlagzeilen zum Thema „Hoffnungsträger“ durchgegangen bin. Als erstes fiel mir ein Artikel über Toni Kroos auf, der, wie es hieß, kurz vor der Fußball-Europameisterschaft nach einer Corona-Erkrankung als„personifizierter Hoffnungsträger“ zur Mannschaft gestoßen sei.
Aber wenn ich Sie, lieber Herr Kessler, einen Hoffnungsträger nenne, dann meine ich nicht so etwas Profanes wie einen Fußballspieler, der die Leute auf erhöhte Siegchancen hoffen lässt. Ich spreche vielmehr von einem Menschen, der in einem viel umfassenderen Sinn Hoffnung trägt, und zwar sowohl in sich als auch nach außen. Eine tiefe Zuversicht, die auch persönlichen und politischen Rückschlägen trotzt: Das ist es, was aus Ihrem publizistischen Werk zu mir spricht. Und ich bin sicher, Ihren Leserinnen und Lesern und den vielen, die Ihre Vorträge hören, geht es nicht anders.
Ich glaube, wir erleben gerade in diesen Tagen den richtigen Moment, um über Hoffnung zu sprechen. Die allgemeine Stimmung wirkt, als stünden wir am hinteren Rand der Krise, wo die Hoffnung zu Hause ist. Und wenn ich mich in den Medien umschaue, stoße ich immer wieder auf genau dieses Wort: Hoffnung.
Da geht es allerdings um etwas ganz anderes als die tief verwurzelte Zuversicht, die ich bei Ihnen, Herr Kessler, spüre. Es wirkt eher so, als warte die Gesellschaft ziemlich tatenlos darauf, gerade so weitermachen zu dürfen wie vor der Pandemie. Nur ein kleines Beispiel: Bei der Fluggesellschaft Eurowings liege die Hoffnung jetzt auf den Sommerferien, habe ich gelesen, weil sie wieder die „Warmwasser-Ziele“ anfliegen kann, also vor allem Mallorca. Was im Klartext nur heißen kann: Es kann bald wieder auf Teufel komm raus geflogen werden, als gäbe es keinen Klimawandel.
Genau das, dieses „Weiter so“ in alten Bahnen verbinde ich gerade nicht mit dem Gefühl der Hoffnung, wie ein Wolfgang Kessler es so meisterhaft zu wecken versteht. Lassen Sie mich also lieber ein anderes Beispiel wählen: Gerade ist eine CD erschienen, auf der sowohl zeitgenössische als auch alte Werke der Gesangskunst zu hören sind. Das „Voktett“, ein Vokal-Ensemble aus Hannover, hat unter anderem die Messe für acht Stimmen von Hans Leo Haßler eingespielt, die im Jahr 1599 entstand. Der Komponist ist übrigens 1612 an Schwindsucht gestorben, und zwar ausgerechnet in Frankfurt – woran eine Gedenktafel hier im Dom erinnert.
Der Titel, den die Sängerinnen und Sänger aus Hannover ihrer CD gegeben haben, lautet: „Glaube – Krise – Hoffnung“. Die Ähnlichkeit mit dem biblischen Dreiklang „Glaube, Hoffnung, Liebe“ ist natürlich beabsichtigt. Aber ebenso beabsichtigt ist die Änderung der Reihenfolge, in der ich zu erkennen glaube, was auch den Kern des Werks von Wolfgang Kessler ausmacht. „Glaube – Krise – Hoffnung“, so ließe sich der Weg beschreiben, den Sie, Herr Kessler, in Ihren Artikeln, Büchern und Vorträgen immer wieder so brillant kartieren.
Am Anfang steht ein Glaube, der mit dem christlichen Glauben jedenfalls nicht zwingend zu tun hat. Es ist eher ein Irrglaube, den die Musikerinnen und Musiker aus Hannover folgendermaßen beschreiben, Zitat: „diese vermeintliche Sicherheit, in der es sich vorzüglich leben lässt, im heimlichen, aber festen Glauben daran, es könne ewig so weitergehen“, Zitat Ende. So weit der Irrglaube. Ihm folgt der zweite Schritt, die Krise, und das gilt keineswegs nur für Pandemien: Sie erschüttert den Irrglauben an ein ewiges Weiter so, Aber dahinter liegt das weite Feld einer unerschütterlichen, unbeirrbaren Hoffnung. Jedenfalls für alle, die dieses Feld zu bestellen wissen.
Glaube – Krise – Hoffnung, vom falschen Glauben an die Unerschütterbarkeit des Bestehenden über die krisenhafte Umwälzung zur Hoffnung: Hoffnung, so verstanden, klammert sich gerade nicht an die passive Fantasie einer Rückkehr zum Gewohnten. Vielmehr erschließt sie sich aus dem Material einer mangelhaften, aber eben auch veränderbaren Gegenwart den großen Möglichkeits-Raum einer besseren Zukunft. Und wer diese Hoffnung trägt, wer sie in sich und dann sogar nach außen trägt, ist für mich ein wahrer Hoffnungsträger. So wie Sie, lieber Wolfgang Kessler.
Wie gesagt: Die Hoffnung, die ich meine, hat mit einem vielleicht zuversichtlichen, oft nostalgischen, aber passiven Warten auf die Rückkehr zu angeblich besseren Zeiten nichts zu tun. Der Kessler’sche Blick in die Zukunft bezieht die Kraft und die ermutigende Wirkung, die ich beim Lesen seiner Texte immer wieder spüre, aus zwei Quellen, die mit Passivität so gar nichts zu tun haben:
Die eine Quelle ist eine humane Haltung zur Welt, die sich durch vermeintliche Sachzwänge eines eingefahrenen Systems nicht korrumpieren lässt. Zum anderen beruht dieser hoffende Blick auf der Gewissheit, dass jede und jeder Einzelne und erst recht die Vielen gemeinsam aktiv handeln können, um die Welt zu verändern. Auch wenn niemand weiß, ob das morgen gelingt oder übermorgen oder in einer ferneren Zukunft. Verkürzt könnte ich sagen: Es ist eine Hoffnung, die sich aus Haltung speist und zum Handeln drängt. Eine Hoffnung, die verstanden hat, was Hannah Arendt einmal so formuliert hat: dass die Freiheit „primär weder im Wollen noch im Denken, sondern im Handeln erfahren wird“.
Es war Walter Dirks, der dieser Lebenshaltung noch in seinen späten Jahren Ausdruck verliehen hat. Peter Glotz, der mit dem katholischen Sozialisten eng verbundene Sozialdemokrat und Publizist, erzählte 2010 in einem Artikel für die „Süddeutsche Zeitung“ von einem letzten Interview mit Dirks kurz vor dessen Tod. „Ich hatte ihn nach seiner Stimmung im hohen Alter gefragt, ob man diese Stimmung mit den Begriffen Pessimismus oder Optimismus beschreiben könne“ notierte Glotz.
Die Antwort des alten Mannes habe gelautet, ich zitiere: „Pessimismus oder Optimismus, das interessiert mich nicht. Wenn mein Arzt mir sagt ,Dein Kind ist in großer Gefahr, seine Lebenschancen sind vielleicht 20 Prozent', so interessieren mich die 80 Prozent Todeswahrscheinlichkeit nur kritisch, indem wir gegen sie arbeiten.
Positiv interessieren mich die 20 Prozent. Ich werde alles tun, damit daraus 25, 50 und schließlich vielleicht 100 Prozent werden." Zitat Ende.
Nachdem das Mikrofon schon abgeschaltet war, so erinnerte sich Glotz, habe Dirks hinzugefügt, ich zitiere noch einmal: „Ich fasse die Hoffnung als eine Kraft auf, die mir hilft, das zu bewirken, was erhofft wird. Die Hoffnung setzt darauf, dass das, was die Optimisten erhoffen, noch erreicht wird – auch gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Pessimisten Recht behalten werden." Zitat Ende.
Sich den Drang zum Handeln nicht vermiesen zu lassen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gegen die Realisierbarkeit einer besseren Welt zu sprechen scheint: Das war die Lebenshaltung eines Walter Dirks, und das ist es, was Sie, Herr Kessler, mit seinem Vermächtnis verbindet.
Mir fällt dabei der Titel eines Buches ein, das ich vor ungefähr 15 Jahren mit Ihnen zusammen herausgeben durfte: „Macht’s besser“, hieß es, und diese Floskel stand hier nicht für Selbstoptimierung im Sinne des besseren Funktionierens unter den gegebenen Umständen. „Es“ besser zu machen, das hieß und heißt für Sie, Herr Kessler, die Umstände, die Umwelt und die Gesellschaft zu verbessern, wo sie der Suche nach dem persönlichen und dem gemeinsamen Glück im Wege stehen. Dort also, wo ökonomische Macht die Freiheit nicht ermöglicht, sondern einschränkt; wo vermeintliche Lebensqualität mit Zerstörung der Lebensgrundlagen erkauft wird; wo menschliche Bedürfnisse wie Gesundheit oder das Dach über dem Kopf einem Markt überlassen werden, der sie ausgerechnet den Bedürftigsten vorenthält.
All das „besser zu machen“, war schon vor 15 Jahren Ihr Thema. Und es ist kein Wunder, dass auch Ihr neues Buch wieder den Imperativ des „Machens“ im Titel trägt: „Macht Wirtschaft“ heißt es diesmal, und wieder gelingt hier die typisch Kessler’sche Mischung: Einerseits finden sich, fundiert und doch leicht verständlich begründet, eine ganze Reihe politischer Forderungen, die sich eher an staatliche und andere öffentliche Institutionen richten. Auf der anderen Seite steht der durchaus dringende, aber immer sanft gehaltene Appell an uns alle, selbst etwas für eine bessere Welt zu tun.
Aber, und das erscheint mir ebenso wichtig: Nie vergisst ein Wolfgang Kessler darauf hinzuweisen, dass das Erkennen von Risiken und Nebenwirkungen unserer Lebensweise, das Leben mit Krisen und Konflikten, dass auch das oft mühsame Engagement für eine bessere Welt keineswegs mit schlechter Laune verbunden sein muss, wie sie sich allzu oft auch in die schönste Gesellschaftskritik mischt.
„Die Welt verändern und das Leben genießen“, so hieß der Untertitel des eben erwähnten Buches, das wir gemeinsam herausgegeben haben. Und das neueste Werk endet mit persönlichen Tipps für Menschen, die eben genau das wollen: die Welt verändern und das Leben genießen.
Da heißt es, Zitat: „Engagement kann nicht ,nur‘ zu Erschöpfung führen, sondern auch in einen Fanatismus münden, der nichts anderes mehr wahrnimmt als Probleme, nichts anderes akzeptiert als das eigene Tun und nur noch Freunde und Feinde kennt.“ Zitat Ende. Und als wichtigste Strategie gegen diese destruktive, ich könnte auch sagen: hoffnungslose Form des Engagements nennen Sie, lieber Herr Kessler, ein vermeintlich einfaches Mittel: „Neben den Schatten- auch die Sonnenseiten des Lebens genießen und locker werden. Motto: Ich weiß, dass ich die Welt alleine nicht verändern kann, aber ich versuche es.“ Zitat Ende. Mir ist da sofort der Romantitel von Ilija Trojanow eingefallen: Die Welt ist groß und Rettung lauert überall.
Das also ist die Zuversicht, die ich an Menschen wie Wolfgang Kessler so sehr bewundere. Als wir uns vor einiger Zeit in der Vorbereitung auf den heutigen Abend unterhielten, ist mir wieder einmal dieses ständig mitschwingende Lächeln aufgefallen, das Sie unter Ihrem Schnauzer nur halb verbergen. Auf mich wirkt das wie eine zutiefst vertrauenerweckende Maßnahme, ein Ausdruck unbedingter Offenheit gegenüber dem Anderen, so anders im Wortsinne er oder sie auch sein mag. Und ich weiß natürlich, dass solche Offenheit nur denen gelingt, die bei sich selbst zu Hause sind. Wer sich durch das Neue, das Unbekannte oder gar Fremde ständig bedroht fühlt, wird niemals die Kraft besitzen, sich zu öffnen. Wohin das führt, erleben wir ja gerade in diesen Zeiten nicht zuletzt in der Politik.
Bei sich selbst zu Hause sein, innerlich stark, ohne sich anderen gleich überlegen zu fühlen: Das ist die wahre Kunst der Hoffnungsträger. Es ist eine Fähigkeit, die sicher von vielen Faktoren begünstigt wird: von dem sozialen und familiären Umfeld, in dem jemand aufwächst; von einem inspirierenden Freundeskreis; von Mentoren, die einem als jungem Menschen Mut gemacht haben. Aber am Ende geht es eben auch nicht ohne einen tiefen und starken Willen, sich nicht mitreißen zu lassen von irgendwelchen herrschenden Dogmen, seien sie nun politischer, ökonomischer oder religiöser Herkunft.
Es ist, da bin ich sicher, Herr Kessler, Ihre besondere Form der Spiritualität, die Ihnen zu dieser inneren Freiheit verhilft. Es ist eine Spiritualität, die mit der ritualisierten Frömmigkeit mancher kirchlichen Veranstaltung wenig zu tun hat.
Eine Spiritualität, die Sie auch Ihren Leserinnen und Lesern unermüdlich empfehlen, ganz gleich, ob sie religiösen, weltanschaulichen oder anderen Quellen entspringt. Dahinter steckt, so glaube ich, eine Ihrer bedeutendsten Erkenntnisse: dass eine noch so schöne neue Welt nie gedeihen kann, wenn sich die Menschen in ihr nicht wohler fühlen als in der alten. „Das Argument allein“, haben Sie mir gesagt, „ist nicht genug“. Besser kann man sich nicht versichern gegen dogmatische und am Ende autoritäre Ideologien.
Ich kann nicht wirklich beurteilen, woher Sie die Kraft zu dieser Art menschenfreundlicher Hoffnung nehmen. Aber als ich Sie mit sanfter Ironie von Ihrer Familie erzählen hörte, stellte sich bei mir der Eindruck eines relativ stabilen Wurzelwerks ein, aus dem Ihre Lebensleistung wachsen konnte. Als „konservativ-fürsorglich“ und „behutsam“ haben Sie Ihre Eltern bezeichnet, und ich habe noch sehr gut im Ohr, wie Sie die Verhältnisse in Ihrer Heimat beschrieben haben: „Oberschwaben war eine Koalition aus katholischer Kirche, CDU und Sparkasse“. Was Ihren leicht rebellischen Vater, einen Katholiken mit viel Spott für seine Kirche, zu folgender Maxime veranlasste: „Wähle FDP und gehe nicht zur Sparkasse.“
Ich vermute mal, dass Sie diesen Rat – FDP wählen und die Sparkasse meiden – heute höchstens teilweise beherzigen. Aber dieser Eigensinn, der ja vor allem aus gesunder Distanz zu eingefahrenen Gleisen aller Art besteht, der scheint sich doch vererbt zu haben. Ihr Vater sei mit einer „tiefen Abneigung gegen das System von Befehl und Gehorsam“ aus dem Krieg gekommen, haben Sie mir erzählt. Da war es nur folgerichtig, dass Sie das Trommlerkorps beim Ravensburger Rutenfest verlassen haben, weil dort im Gleichschritt marschiert wurde. Und ebenso folgerichtig war die Kriegsdienstverweigerung, als einziger im Schuljahrgang.
So viel zur Familie. Erwähnen muss ich noch die Katholische Jugend, in der Sie so etwas wie Kirche offenbar von der positiven Seite erlebt haben: als Ort, wo Nächstenliebe eben auch als internationale Verantwortung besprochen wurde, als Einsatz für Frieden und Versöhnung im Sinne Willy Brandts, der damals zum Idol vieler Jugendlicher wurde. Als Ort aber auch, wo Sie sich über „Lebensfragen“ austauschen konnten, wie Sie es genannt haben. Wahrlich eine Parallele zur Biografie von Walter Dirks und seinen jungen Jahren. Und unbedingt zu erwähnen ist schließlich der Jugendpfarrer Werner Redies, der Ihnen später für die inquisitorische Befragung zur Kriegsdienstverweigerung einen wunderbar einfachen und doch unendlich anspruchsvollen Rat mitgab: Du sagst einfach die Wahrheit.
Das mögen alles günstige Umstände gewesen sein, neben manchen weniger günstigen. Entscheidend ist, wie Sie daraus mit Ihrer eigenen Kraft, Ihrem stabilen ethischen und politischen Kompass ein wunderbares Lebenswerk gestaltet haben.
Ich will nicht alle Stationen Ihres beruflichen Lebens ausführlich nacherzählen, lieber Herr Kessler. Nicht das Studium der Wirtschaftswissenschaften, nicht die Station beim Internationalen Währungsfonds, dessen damalige Politik Ihnen furchtbar gegen den Strich gegangen sein muss. Auch nicht die ersten journalistischen Arbeiten bei der „Badischen Zeitung“; und selbst die 28 Jahre bei „Publik Forum“, davon 20 als Chefredakteur, muss ich nicht allzu ausführlich schildern.
Nur folgendes möchte ich dazu sagen: Es heißt, Sie hätten die Kolleginnen und Kollegen gern ausreden lassen. Wer öfter an Redaktionskonferenzen teilgenommen hat, kann ermessen, wie viel Kraft schon das manchmal erfordert. Und insgesamt muss die Atmosphäre in der Redaktion unter Ihrer Leitung von einem angenehmen, durchaus fordernden, aber keineswegs autoritären Führungsstil geprägt gewesen sein. Ein „leistungsorientiertes Arbeitstier“ seien Sie gewesen, hat mir Ihr Kollege Thomas Seiterich erzählt, aber zugleich ein „großzügiger Motivierer“ mit „großer Empathie“ für die Kolleginnen und Kollegen; eine „Kombination aus geduldig und durchsetzungsstark“. Wer als ehemaliger Chef so beschrieben wird, muss eine Menge richtig gemacht haben.
Aber noch wichtiger ist, dass diese Zeitschrift, getragen von den weltoffenen, undogmatischen und reformwilligen Kräften einer weithin dem Stillstand ergebenen Kirche, unter Ihrer Führung zu einem viel zu wenig beachteten Muster an journalistischer Qualität und unbeirrbarer Haltung geworden ist. Und dazu muss ich, bevor ich zum Ende komme, noch einige Worte verlieren.
Es ist dem Projekt „Publik-Forum“ schon von seiner Geschichte her der Verzicht auf jede Beliebigkeit eingeschrieben. Wer dort arbeitet und wer die Zeitschrift liest, erwartet nicht diesen allzu weit verbreiteten Journalismus, der sich einem irrigen Verständnis vermeintlicher Objektivität verschrieben hat. Zumindest unter Ihrer Leitung, lieber Herr Kessler, hat „Publik-Forum“ immer gezeigt, dass ein klarer Standpunkt und eine wahrhaftige Wiedergabe von Fakten keineswegs im Widerspruch zueinander stehen.
Das ist leider nicht selbstverständlich. Zu viele unserer journalistischen Kolleginnen und Kollegen glauben, sie seien objektiv, wenn sie so tun, als sei das, was sie erzählen oder schreiben, die einzig wahre Wahrheit. Wenn ihr Standpunkt in die Berichterstattung einfließe, so glauben sie, werde das Ganze ideologisch. Aber sie merken nicht, dass es gerade dann ideologisch wird, wenn sie sich einfach zum distanzlosen Verstärker politischer, ökonomischer oder auch anderer Interessen machen – allzu oft zum Verstärker gerade derjenigen Interessengruppen, die ohnehin leichter Zugang zu den Medien haben als andere.
Ich plädiere deshalb für einen Journalismus, der sich einerseits sehr wohl um Wahrhaftigkeit bemüht. Weder Beliebigkeit noch pures Meinen ohne Recherche noch das Verneinen unbestreitbarer Fakten sind das, was ich meine. Ich rede davon, dem Publikum die Welt so zu zeigen, wie wir sie nach gewissenhafter Recherche und Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen sehen. Und ich finde, wir sollten lernen, diese unsere Perspektive in der Berichterstattung transparent zu machen, statt so zu tun, als beschrieben wir nicht unsere Sicht der Dinge, sondern die objektive Wahrheit.
Ich bin sehr froh, dass es in der kriselnden Medienlandschaft eine Zeitschrift gibt, die genau das praktiziert: seriösen Journalismus mit Haltung. Haltung nicht im Sinne der Präferenz für irgendeine Partei oder Ideologie, sondern im Sinne einer Ethik, die die öffentlichen Angelegenheiten, auch die kirchlichen, konsequent von den Menschen her denkt, besonders von den Vernachlässigten und Benachteiligtn. Sie, Herr Kessler, haben dazu entscheidend beigetragen. Und ich hoffe, dass Ihr Lebenswerk in diesem Sinne fortgesetzt wird.
„Hoffnung“, hat der Sozialpsychologe Erich Fromm geschrieben, „ist paradox. Sie ist weder ein untätiges Warten noch ein unrealistisches Herbeizwingenwollen von Umständen, die nicht eintreffen können. Sie gleicht einem kauernden Tiger, der erst losspringt, wenn der Augenblick zum Springen gekommen ist. Weder ein müder Reformismus noch ein pseudo-radikales Abenteurertum ist ein Ausdruck von Hoffnung. Hoffen heißt, jeden Augenblick bereit sein für das, was noch nicht geboren ist, und trotzdem nicht verzweifeln, wenn es zu unseren Lebzeiten nicht zur Geburt kommt.“ Zitat Ende.
In diesem Sinne lassen Sie uns in „paradoxer Hoffnung“ „die Welt verbessern und das Leben genießen“. Mit wem sollte das besser gehen als mit dem Hoffnungsträger Wolfgang Kessler! Ich gratuliere Ihnen von Herzen zum Walter-Dirks-Preis.
Dankesrede des Preisträgers
Dr. Wolfgang Kessler
Ja, was bleibt mir hier angesichts dieser würdigenden Worte von allen Seiten zu sagen.
Zunächst mal: Dankeschön an Sie, an Euch, die Ihr hier diese Ehrung mit mir teilt.
Ich finde es großartig, hier Menschen zu treffen, die ich viele Monate nicht gesehen habe oder deren Gesichter durch die Kommunikation über Bildschirme genau so verzerrt wurden wie meines. Herzlichen Dank für Eure Mühen, Eure langen Wege, die Ihr auf Euch genommen habt.
Und natürlich: Tausend Dank an Stephan Hebel – natürlich für diese persönliche Laudatio, die mich sehr gerührt hat und zu der ich gar nicht mehr sagen möchte, als einfach: Danke
Danke möchte ich Ihnen, Herr Hebel, aber auch für Ihren Mut, in der deutschen Medienwelt immer eine jener kritischen, unbestechlichen Stimmen zu sein, die in der sensationsheischenden Sucht der Medien nach Aufmerksamkeit um jeden Preis allzu oft untergehen;
Und dann natürlich:
Tausend Dank an die Jury, die mich als würdig empfunden hat, den Walter und Marianne Dirks zu tragen;
Ich möchte nicht mit Bescheidenheit kokettieren, aber für mich war diese Wahl schon sehr überraschend.
Ich wandelte zwar immer wieder auf den Spuren von Walter Dirks, aber ich durfte ihn nie persönlich kennenlernen.
Ich kam immer irgendwie zu spät.
Als jemand, der von der katholischen Jugendarbeit geprägt ist, trat ich Anfang der 1980er Jahre dem sogenannten links-katholischen Bensberger Kreis bei
Dort war der Name Walter Dirks in aller Munde.
Kein Wunder, er hatte den Bensberger Kreis zusammen mit Eugen Kogon und Freundinnen und Freunden von Pax Christi gegründet.
Dort waren die Ideale von Walter Dirks – aufrechter Glaube, freiheitlicher Sozialismus, Versöhnung, europäische Einigung – ständig präsent.
Er hat das Memorandum des Kreises zur Versöhnung zwischen Deutschland und Polen mitverfasst – und wurde dadurch zu einem der Vordenker für Willy Brandts Ostpolitik.
Nur, als ich diesem illustren Kreis beitrat und selbst an mehreren Memoranden mitarbeitete, hatte sich Walter Dirks zurückgezogen.
Verdientermaßen. Er war gerade 80 Jahre alt geworden.
Bei der nächsten Chance, ihn kennen zu lernen, war ich auch zu spät dran.
Es war im Frühjahr 1991, als ich in die Redaktion von Publik-Forum eintrat.
Dort traf ich meinen Kollegen Thomas Seiterich, mit dem ich dann viele Jahre zusammenarbeiten durfte.
Er hat seine Doktorarbeit über Walter Dirks geschrieben und erzählt mir immer wieder von Besuchen bei Marianne und Walter Dirks im badischen Wittnau.
Auch Thomas stammt aus dem Badischen
Bevor ich selbst an einen Besuch denken konnte, verstarb Walter Dirks leider – am 30. Mai 1991, also vor dreißig Jahren.
Obwohl ich Walter Dirks nie persönlich treffen durfte, so empfinde ich es doch als sehr große Ehre, in seiner Tradition einen Preis entgegen nehmen zu dürfen.
Ich empfinde überhaupt die Vergabe eines Walter Dirks Preises als wichtig.
Denn kongeniale, aber gleichzeitig kontroverse Persönlichkeiten wie Walter Dirks, die sich einer klaren Vereinnahmung durch Parteien, Verbände oder Kirchen entziehen , drohen immer in Vergessenheit zu geraten.
Wer als Christ und Christdemokrat und regelmäßiger Gottesdienstbesucher den freiheitlichen Sozialismus propagiert, gilt bei den Schwarzen als Roter und bei den Roten als Schwarzer – und steht in Gefahr von beiden Seiten verdrängt zu werden.
Doch auch wenn manche die Person Walter Dirks gerne verdrängen würde, auch wenn der Begriff „Sozialismus“ durch Verbrechen von Diktaturen in Misskredit gebracht wird –
So sind doch die Prinzipien, die Ziele von Walter Dirks - freiheitlicher Sozialismus, Versöhnung, Europa und christlicher Glaube – auch heute noch sehr wichtig.
Auch wer den Begriff „Sozialismus“ als Zukunftsperspektive meidet, kann kaum bestreiten, dass Alternativen zum harten Kapitalismus benötigt werden.
Was gerne und lieblich als soziale Marktwirtschaft verniedlicht wird, ist ein Investoren-Kapitalismus, der die natürlichen Grundlagen der Erde bedroht und die Lebensgrundlagen der Menschen einem platten Renditedenken unterwirft.
Inzwischen besitzen wenige Großkonzerne Hundertausende Wohnungen, 45 Prozent aller Krankenhausbetten und 25 Prozent aller Pflegebetten.
Sogar in einer Kleinstadt muss man – wie ich auf der Suche nach einem Pflegeheimplatz für meine Frau erfuhr - damit rechnen, dass das ansässige Pflegeheim einem Finanzinvestor gehört, der seinen Hauptsitz in der Steueroase Jersey Island hat.
Nun bin ich nicht gegen privates Engagement für Wohnen, Pflege und Gesundheit – allerdings sind Mieter für viele Großinvestoren nicht in erster Linie Mieter, Pflegebedürftige nicht in erster Linie Pflegebedürftige und Kranke nicht in erster Linie Kranke – sondern alle sind Renditeobjekt für ihre Anlegerinnen und Anleger.
Man könnte dies auf andere Lebensbereiche ausdehnen.
Und würde feststellen, dass sich der renditehungrige Kapitalismus immer mehr Lebensbereiche unterworfen.
Und nicht zuletzt diese Entwicklung ist dafür verantwortlich, dass die Vermögen in einem Land wie Deutschland immer ungleicher verteilt sind, dass die Spitzeneinkommen inzwischen um ein 50faches höher sind als die Durchschnittseinkommen.
Und man braucht auch gar nicht darum herumreden, dass die größten und existenziellsten Herausforderungen – das Artensterben und die Klimakrise - mit einem Wachstums-Kapitalismus zu tun hat, der sich die Natur unterwirft und zu privatem Reichtum macht, in dem Regenwälder zerstört werden, um Palmöl zu exportieren oder Gensoja – in dem immer und überall nach Rohstoffen gebuddelt und die Umwelt zerstört wird; indem überall rastlos fossile Produkte verbrannt und die Erde aufgeheizt wird.
Man kann lange darüber philosophieren, ob der Begriff „Sozialismus“ im Reigen der Alternativen eine Rolle spielen soll.
Aber sicher ist, dass wir Alternativen zu diesem Kapitalismus entwickeln müssen:
Neue kooperative Eigentumsformen; ein Wirtschaften ohne diesen Renditedruck, Wohnformen , Gesundheits- und Pflegesysteme, die die Bedürfnisse der Mieter, der Kranken und der Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt stellen.
Und natürlich brauchen wir Alternativen zu einer Steuerpolitik, die die Reichen schont und Ärmeren belastet
Und wir brauchen Alternativen zu einer kompromisslosen Wachstumspolitik.
Zukunft hat nur eine Wirtschaftsweise, die der Erde so viele Ressourcen entnimmt wie nachwachsen:
Das ist die alte Definition von nachhaltiger Entwicklung durch den Club of Rome
Wenn diese Veränderung in Freiheit geschehen sollen, dann wäre wir wohl nicht mehr weit von dem entfernt, was Walter Dirks mit „freiheitlichem Sozialismus auf chrislticher Grundlage“ gemeint haben könnte.
Und seine Vision eines einigen demokratischen und sozialen Europa, das Frieden stiftet, ist ebenfalls aktueller denn je.
Ich selbst bin froh, Europäer zu sein.
Man kann der Europäischen Union viel Negatives nachsagen, aber sie ist die einzige Region der Erde, in der wenigstens versucht wird, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Ökologie gemeinsam zu denken.
Und es ist nach wie vor eine Region, in der die Versöhnung von Todfeinden mit friedlichen Mitteln gelungen ist, zwischen Deutschen und Franzosen, auch zwischen Polen und Deutschen.
Umso irritierender ist es deshalb für mich dass diese Europäische Union in den vergangenen Jahrzehnen tiefe Risse bekommen hat.
Auch hier wirkt der Kapitalismus stärker als das Streben nach Gerechtigkeit –
Auch hier herrschen Konzerne, ohne Steuern zu zahlen.
Auch hier ist Klimapolitik mühevoll – und Demokratie noch mühevoller.
Auch hier zerbrechen sich viele Verantwortliche schneller den Kopf über Waffen und Armeen als über kreative Möglichkeiten friedlicher Konfliktlösungen.
Und wer wollte bestreiten, dass die Europäische Union von autoritären, rechtsextremen Bestrebungen im Innen bedroht ist, im Äußeren droht sie zwischen den USA, Russland und China zerrieben zu werden.
Sie konkurriert mit autoritären Systemen und muss den Weg finden zwischen Konfrontation und der Bereitschaft zur Kooperation.
Trotz allem sind die Voraussetzungen für den Einklang von Demokratie, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung nirgendwo auf der Welt besser als in der Europäischen Union.
Ich kann mir vorstellen, dass Walter Dirks auf seine Art radikaler, kritischer geurteilt hätte – aber ich bin auch sicher, dass er meine Position respektiert hätte.
Und der Glaube?
Walter Dirks war ein frommer Mensch.
Er ging unter der Woche für bedrohte Arbeiter auf die Straße – und am Sonntag in die Kirche.
Und erntete auf beiden Seiten Unverständnis.
Aber sein Glaube gab ihm die Kraft für sein Engagement.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir so eine Kraft, so einen Glauben in den kommenden Jahrzehnten wieder brauchen.
Klar, ich weiß, dass ich damit bei vielen Gesprächspartnerinnen/Gesprächspartner auf Skepsis stoße.
Sie setzen auf das Wort, auf das Argument, auf eine neue Aufklärung.
Glaubt mir. Da bin ich auch dabei.
Ich bin Journalist.
Andererseits verkenne wir bitte nicht.
Klimaschutz, weltweite Gerechtigkeit, Migration – das sind nicht Problem wie viele andere, die man einfach durch Gesetze wird lösen können.
Gegen die Klimakrise gibt es auch keine Impfung.
Die Politik und wir alle werden wir die großen Probleme der Gerechtigkeit, die Klimaprobleme, die Migration nur lösen, wenn wir Vieles grundlegend anders machen:
Wenn wir anders wirtschaften, anders arbeiten, anders mit der Natur umgehen, anders miteinander umgehen, anders Urlaub machen – kurz gesagt: anders leben.
Und klar ist doch: Das wird uns nicht immer leicht fallen – Euch nicht und mir nicht.
Dies spüren viele – und das ist das Problem.
Wir leben in einer Übergangs-Gesellschaft:
Das Alte scheint immer weniger tragfähig – das Neue aber noch nicht sichtbar.
Dies löst Angst aus
Und Angst macht konservativ.
Man klammert sich an das, was man hat
Dieses Klammern blockiert Veränderungen
Um diese Angst aufzulösen, zu überwinden, braucht es mehr als gute, rationale Argumente und kritische Informationen:
Für diese Veränderung braucht es einen Spirit, der auch die Gefühle der Menschen erreicht.
Es brauche nicht unbedingt den christlichen Glauben eines Walter Dirks.
Es braucht aber einen Glauben.
In der wissenschaftlich, eher intellektuell und faktisch orientierten Welt von heute werden solche Thesen oft ignoriert oder gar belächelt. Aber der Blick auf große historische Umwälzungen zeigt dies.
So pries der ehemalige südafrikanische Staatspräsident Nelson Mandela immer wieder den gemeinsamen Spirit der Befreiung, der den Kampf gegen das Apartheid-System getragen – und einen friedlichen Übergang ermöglicht hatte.
In der Friedlichen Revolution in Ostdeutschland von 1989 spielte die christliche Spiritualität eine viel größere Rolle als allgemein angenommen. Ich erinnere mich noch gut an die Worte meiner langjährigen Berliner Kollegin Bettina Röder, die an vorderster Front für die friedliche Revolution stritt: „Was die SED mehr fürchtete als unsere Argumente und politische Strategien waren unsere Kerzen“.
Und in Bhutan konnte ich persönlich beobachten, wie ein kleines Land eine eigenständige Entwicklung hin zu einem ganzheitlichen Bruttosozialglück für alle Bürger beschreitet – als Alternative zur reinen Konsumkultur des Westens. Diese Entwicklung wäre nicht möglich ohne das einigende Band des Buddhismus.
Der Glaube an eine Alternative zum Kapitalismus, der Glaube an Versöhnung und der Glaube an Gott, um diese großen Ziele – er hat Walter Dirks voller Hoffnung auch in Zeiten großer Veränderungen getragen.
Wie sehr, das sagte er in einem seiner letzten Gespräche in hohem Alter – das mich genauso beeindruckt hat wie Stephan Hebel:
„Die Hoffnung setzt darauf, dass das, was die Optimisten erhoffen, noch erreicht wird – auch gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Pessimisten Recht behalten werden. Daran klammere ich mich.“
Lassen wir uns bei den notwendigen Veränderungen, die vor uns liegen, von dieser Hoffnung tragen.
Danke.















